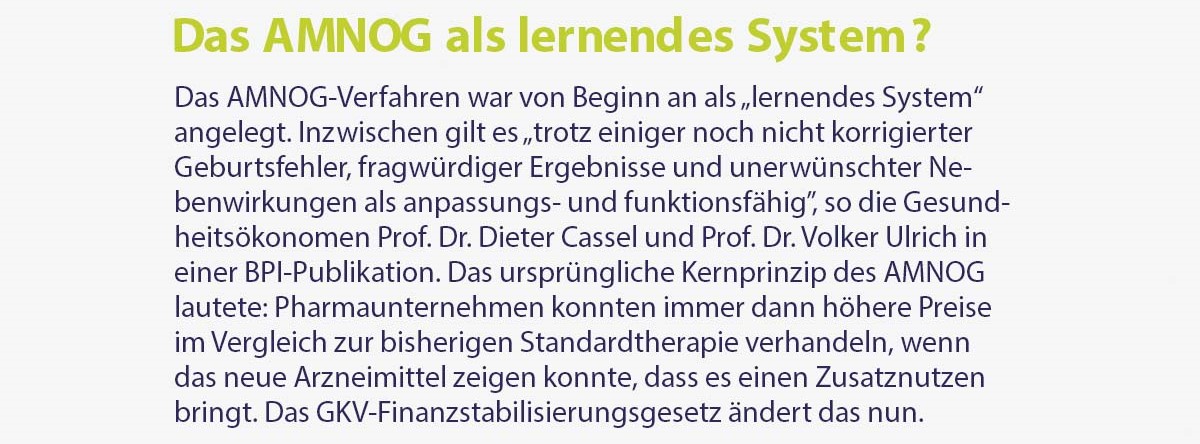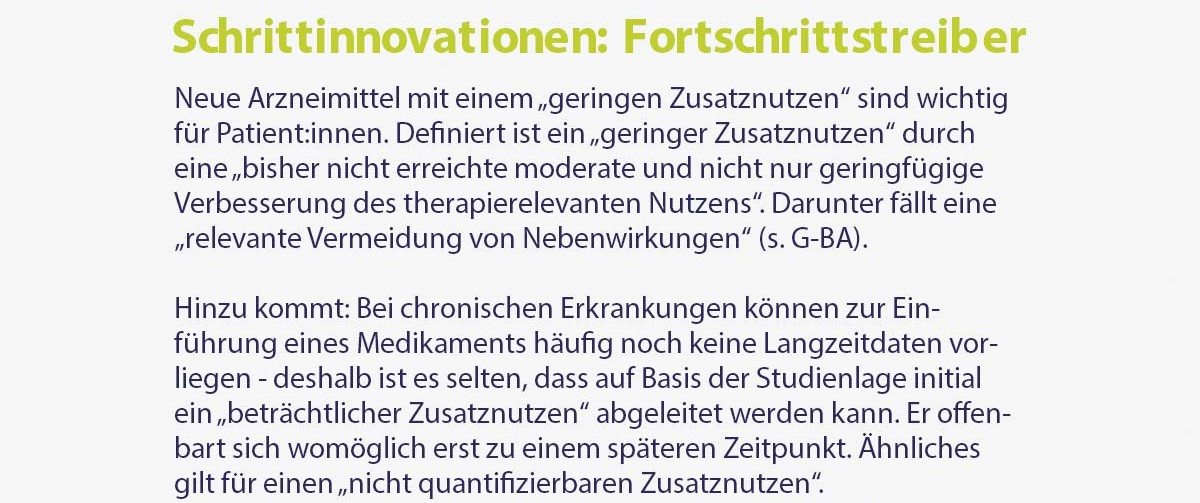In einem Vortrag sprachen Sie von Fehlern I. Ordnung bzw. II. Ordnung, die in Gesundheitssystemen passieren können. Was meinen Sie damit?
Prof. Dr. med. Jörg Ruof: Ein Fehler erster Ordnung ergibt sich, wenn Medikamente ohne Zusatznutzen zusätzliche Kosten für das System verursachen. Bei einem Fehler zweiter Ordnung wird man als pharmazeutisches Unternehmen für ein innovatives Medikament, bei welchem ein Zusatznutzen vorliegt, keinen höheren Preis erreichen können als für die unterlegene Vergleichstherapie, weshalb dieses dann ggf. auch in der Versorgung nicht mehr zur Verfügung steht.
Wie können diese beiden Fehler entstehen?
Ruof: Wenn man das amerikanische mit den europäischen Gesundheitssystemen vergleicht, so gibt es in den USA bislang keine frühe Nutzenbewertung für innovative Medikamente wie das in Deutschland seit Einführung des AMNOG üblich ist. Daraus resultiert folgendes: Innovative Medikamente stehen in den USA nahezu regelhaft früher in der Versorgung zur Verfügung – aber es werden eben auch Medikamente ohne Zusatznutzen eingeführt, die zum Teil höhere Kosten für das System bewirken können. Im Gegensatz dazu stehen in vielen europäischen Ländern Medikamente mit Zusatznutzen teilweise sehr verzögert in der Versorgung zur Verfügung. Hier ist das AMNOG bislang als positive Ausnahme hervorzuheben.
Kann es ein perfektes Gesundheitssystem geben, in dem keiner der beiden „Fehler“ vorkommt?
Ruof: Ein perfektes Gesundheitssystem gibt es nicht. ‚Agility‘ wird derzeit als Unternehmenskultur sehr hochgeschätzt. Ebenso benötigen die Gesundheitssysteme ein gewisses Maß an ‚Agility‘, um den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. Und hier hat man doch den Eindruck, dass sich unser deutsches Gesundheitssystem häufig eher durch eine gewisse Schwerfälligkeit auszeichnet, wenn man zum Beispiel an die aktuelle Diskussion zur Krankenhausreform denkt. Fehler haben im deutschen Sprachgebrauch immer eine negative Konnotation. Dabei ist jede Neuentwicklung immer von Fehlern begleitet – Fehler sind deswegen meines Erachtens nichts grundsätzlich Schlechtes, die Frage ist nur, ob man aus Fehlern lernt.
Aufgrund des 2022 beschlossenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes sehen Sie ein erhöhtes Risiko für Fehler der II. Ordnung in Deutschland. Warum?
Ruof: Etwas vereinfacht dargestellt legt die sogenannte Leitplankenregelung des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes fest, dass für Medikamente mit geringem oder nicht quantifizierbaren Zusatznutzen kein höherer Preis zu bezahlen ist als für die unterlegene Vergleichstherapie. Doch Sprunginnovationen sind in der Medizin selten, die größten Fortschritte werden durch sequentielle Schrittinnovationen erzielt. Mit der genannten Leitplankenregelung wird der finanzielle Anreiz für Schrittinnovationen eliminiert. Das entspricht meines Erachtens ziemlich genau der Definition des Fehlers zweiter Ordnung.
Welche Patient:innen könnte das besonders betreffen?
Ruof: In der Arzneimittelnutzenverordnung wird eine Verringerung an Nebenwirkungen zum Beispiel einer Chemotherapie oder eine Verbesserung der Lebensqualität als Kriterium für einen geringen Zusatznutzen genannt. Im Herzkreislaufbereich oder auch bei psychiatrischen Erkrankungen ist ein beträchtlicher Zusatznutzen eine Rarität. Von daher sind solche Krankheitsbilder durch die Regelung stärker betroffen, aber auch in der Onkologie werden Effekte auf die Lebensqualität oder Verbesserungen des Nebenwirkungsprofils künftig nicht mehr finanziell angereizt.
Auf EU-Ebene ist es geplant, die Vielzahl der nationalen Nutzenbewertungen zu neuen Arzneimitteln zu harmonisieren. Wie bewerten Sie das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vor diesem Hintergrund?
Ruof: Die Einführung des Europäischen Health Technology Assessments ist ein wichtiger Schritt, um die Konkurrenzfähigkeit Europas im internationalen Kontext zu stärken. Bekanntermaßen kommt Deutschland eine ganz wichtige gestaltende Rolle im europäischen Kontext zu. Das AMNOG-System hat hier unter vielen Aspekten Vorbildfunktion. Dass jetzt aktuell die fein differenzierenden Nutzenkategorien des AMNOG mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz quasi eliminiert werden, ist in meinen Augen ein vollkommen falsches Signal zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.
Weitere News

Arzneimittelversorgung: Falsches Sparen kommt Deutschland teuer zu stehen
Vor „medizinischen Leistungskürzungen durch die Hintertür“ warnt der Pharmaverband vfa mit Blick auf das 2022 beschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Expert:innen aus Industrie, Wissenschaft, Medizin befürchten, dass die jüngsten Kostendämpfungsmaßnahmen die Arzneimittelversorgung der Menschen in Deutschland verschlechtern. Nun verstärkt der aktuelle AMNOG-Report der Krankenkasse DAK-Gesundheit das Gefühl, dass die neuen Regelungen nicht so richtig durchdacht wurden.

AMNOG-Änderungen: Kurzschluss-Entscheidungen mit Boomerang-Gefahr
In Deutschland wurde vor 12 Jahren das AMNOG in Kraft gesetzt – das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz regelt die Preise neu eingeführter Medikamente. Das Verfahren gilt mittlerweile als etabliert, trotz einiger struktureller Schwächen. Doch mit dem unter Kostendruck zusammengeschusterten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) droht es zu einem reinen Kostendämpfungsinstrument zu werden. Dabei dürfte sich die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln in Deutschland verschlechtern.

GKV-Spargesetz: Ein Gesetz mit unbekannten Folgen
Das vom Bundestag abgesegnete GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wird langfristig Folgen haben, deren Tragweite noch gar nicht abzuschätzen ist. Es sind nicht nur Pharmaunternehmen, die glauben, dass es die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln in Deutschland verschlechtern wird. Ein Kommentar von Florian Martius.